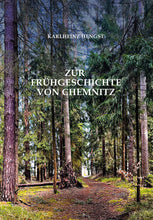Karlheinz Hengst - Zur Frühgeschichte von Chemnitz und zum Westerzgebirge von 800 bis 1200 n. Chr.
€ 22,95
86 Seiten, Format: Din A4, 630g
ISBN 978-3-947291-11-3
Buchpräsentation am Dienstag 2. Dezember, um 18.00 Uhr, im Staatsarchiv Chemnitz, Elsasser Straße 8, 09120 Chemnitz
Die Frühgeschichtsforschung hat für Chemnitz und sein Umland bisher Ergebnisse seit dem 10./11. Jahrhundert ausgewiesen. In den letzten Jahren ist sehr gründlich zur Geschichte von Chemnitz gearbeitet und berichtet worden:
Die Archäologie hat einen ausführlichen Überblick zu den vorliegenden Forschungsresultaten geboten mit dem Ergebnis, dass es vor 1180 keine Bebauungsspuren gibt. Ein völlig einsamer Töpfchen-Fund mit Hinweis auf Mitte des 12. Jahrhunderts aus dem Areal Theater-Straße/Innere Klosterstraße wird angeführt.
Besiedlungsgeschichte, Kirchengeschichte und Landesgeschichte nahmen 2018 das Jubiläum zur 875-Jahr-Feier der Ersterwähnung des locus kameniz dictus zum Anlass, den gewonnenen Erkenntnisstand zusammenfassend und interdisziplinär darzulegen. Archäologische und baugeschichtliche Befunde sowie weitere Gesichtspunkte fanden eine Auswertung.
Auf dieser soliden Basis unternimmt der Linguist Karlheinz Hengst einige weitere Rückblicke in die Frühzeit des heutigen Erzgebirges und Südwest-Sachsens. Möglich wurden diese durch eine transdisziplinäre Verbindung von sprachgeschichtlichen Beobachtungen mit den schon länger vorhandenen Angaben aus der die semitae Bohemicae betreffenden frühgeschichtlichen Altwegeforschung. Diese Altwege führten aus den Altsiedelgebieten von Döbeln, Rochlitz, Altenburg durch die Waldgebiete übers Gebirge bis nach Böhmen. Die Kombination von Fakten aus mehreren Disziplinen ermöglichte es, neue Quellen zur Frühgeschichte aufzutun. Die Analyse urkundlich tradierter sprachlicher Formen von gut bekannten Orten wie Lugau, Oederan, Raschau, Sayda, Wilkau, Zöblitz usw. ergab erste frühe Siedelstellen schon 300 Jahre vor dem deutschen Landesausbau.
In dem Buch wird der Versuch unternommen, für die Zeit ab dem 9. Jahrhundert Aussagen zu ersten menschlichen Niederlassungen noch vor der Gründung der Stadt Chemnitz sowie in SW-Sachsen zu vermitteln.
Zu dem bestehenden Geschichtsbild zur Entstehung von Chemnitz sind jedoch keine Erschütterungen beabsichtigt. Es geht aber für die bisher im 12. Jahrhundert einsetzende Geschichte um Ergänzungen zu der Zeit vorher, sowohl für das heutige Chemnitz als auch für das Westerzgebirge und sein Vorland.
Zum Autor:
Karlheinz Hengst (2. 3. 1934 in Marienberg/Sachs.) ist bekannt als Sprachforscher insbesondere zur deutsch-slawischen Kontaktlinguistik. Zuletzt war er von 1993 bis 2000 „Professor für Onomastik mit besonderer Berücksichtigung des deutsch-slawischen Sprachkontakts“ an der Philologischen Fakultät der Universität Leipzig. Er ist seit 1965 verheiratet mit Dr. Brigitte Hengst. Beide sind Eltern von einem Sohn und einer Tochter.
Nach dem Abitur 1952 in Chemnitz studierte Hengst in Leipzig Slavistik, Lituanistik, Pädagogik und Psychologie. Nach Lehramts- und Diplomprüfung war er 1956 bis 1959 Fremdsprachenlehrer am heutigen Carl-von-Bach-Gymnasium in Stollberg/Erzgeb. 1959 wechselte er als Fremdsprachenlektor in die Ausbildung von Lehrern, zunächst im damaligen Karl-Marx-Stadt, ab 1963 in Zwickau.
Von 1961 bis 1963 arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent in der Forschung am Slawischen Institut der Universität Leipzig und promovierte 1963 mit einer Dissertation zur Sprach- und Siedlungsgeschichte einer Region in Westsachsen. Von 1963 bis 1993 leitete er den Bereich Fremdsprachen an der Pädagogischen Hochschule Zwickau.
1972 habilitierte er sich in Leipzig mit einer Arbeit zur deutsch-slawischen Sprachkontaktforschung. 1973 erfolgte seine Berufung zum a. o. Professor für Angewandte Sprachwissenschaft, 1985 die Berufung zum ordentlichen Professor. Von 1973 bis 1990 war er Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats für Fremdsprachen im Hochschulwesen der damaligen DDR. Von 1974 bis 1990 oblag ihm die zentrale Ausbildung von Aspiranten und Forschungsstudenten zu Themen aus der Fachsprachenforschung im Bereich Lehrerbildung mit Promotion an der Pädagogischen Hochschule Zwickau.
Als Direktor des Instituts für Fremdsprachen ab 1988 leitete er von 1990 bis 1992 zugleich als gewählter Dekan den Aufbau von Anglistik und Französistik an der PH Zwickau und wirkte mit an der Fusionierung der PH mit der TU Chemnitz. 1993 und 2003 folgte er jeweils für ein Semester der Einladung an die Universität Marburg zur Vertretung der Professur für slawische Sprachwissenschaft.
Nach der Wende wurde Hengst auf die damals deutschlandweit erste Professur für Onomastik nach Leipzig berufen und verantwortete den Aufbau des ebenso unikalen Nebenfachstudiengangs „Deutsch-Slawische Namenforschung (Onomastik)“.
Von 1969 in Wien bis 2005 in Pisa hat Hengst an nahezu allen nationalen Tagungen und internationalen Kongressen zur Onomastik im In- und Ausland aktiv mitgewirkt. In den letzten 20 Jahren beschränkte er seine Aktivitäten mehr und mehr auf Sachsen und Thüringen. Als Autor zahlreicher Publikationen ist er weithin bekannt und hat sich auch durch sein Mitwirken an regionalen Konferenzen sowie in heimatkundlich orientierten Zeitschriften einen großen Interessentenkreis erschlossen.
Von 1994 bis 2017 war er Mitherausgeber der Zeitschrift „Namenkundliche Informationen/ Journal of Onomastics“ (Universitätsverlag Leipzig). Seit 2003 ist er einer der drei Herausgeber der Reihe „Onomastica Lipsiensia“ und seit 2004 Mitglied des Redaktionsbeirats der internationalen Fachzeitschrift „Problems of Onomastics“.
2005 bis 2007 betreute er die MDR-Fernsehreihe „Namen auf der Spur“ in allen ihren Folgen. Er zählt als Initiator zum Mitbegründer des Langzeitforschungsvorhabens „Historisches Ortsnamenbuch von Thüringen“ an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er ist bis heute Mitglied im „Verband der deutschen Slavistik“, ebenso der „Gesellschaft für Namenforschung“, des „International Council of Onomastic Sciences” sowie der Historischen Kommission bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.