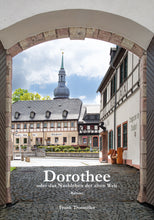356 Seiten, 470 g, 21 x 15 x 2 cm
ISBN 978-3-947291-12-0
Im Roman über die Thomallas rückt Frank Trommler das Schicksal des sächsischen Wirtschaftsbürgertums in seinem Auf- und Abstieg ins Blickfeld. Mit dem erfolgreichen Aufbau einer weitbekannten Schuhfirma im Erzgebirge erlangte Eugen Thomalla in Chemnitz Prominenz und im Berlin der zwanziger Jahre Weltläufigkeit. Er gewinnt die lebenslustige, wesentlich jüngere Dorothee zur Ehefrau, die sich in der Kleinstadt nur mürrisch einlebt, dann aber in den Herausforderungen durch das NS-Regime, die bis in die Familie hineinreichen, durch Krieg, Flüchtlingswelle und russische Besatzung ihre Selbstständigkeit als Chefin erwirkt. Während Eugen, vom Kriegsdienst und russischer Gefangenschaft zermürbt, seine Lebenskraft verliert, bewährt sie sich in der Erhaltung der ihr überantworteten Welt. Bis sie sich davon löst und mit der Flucht in den Westen glaubt, die alte Welt hinter sich lassen zu können. Es sind nicht nur ihre Kinder, die ihr bezeugen, dass das nicht gelingen kann.
Zunächst präsentiert „Dorothee oder das Nachleben der alten Welt“ die alte Welt in den Stationen industriellen Aufbaus einer Massenfabrikation von Schuhen. Mit ihr bewährte sich Eugen Thomalla in den Unruhen der Weimarer Republik und findet in der neuerlich zu Geld gekommenen Bürgergesellschaft von Chemnitz Konkurrenz, Anerkennung und — seine zukünftige Frau. Später verliert diese Welt aus der Perspektive der jungen Ehefrau Dorothee trotz weiterer geschäftlicher Erfolge angesichts der Macht des NS-Regimes viel von ihrer Dominanz. Nach Kriegsende findet sich Dorothee, zunächst gegen ihren Willen, in der Verpflichtung gefangen, diese Welt und ihre Lebensformen gegen die Auflagen von Besatzung und kommunistischer Herrschaft zu verteidigen. Das kann nur eine Zeit lang dauern.
Drei andere Charaktere spielen wichtige Rollen. Zentral ist Thomallas Freundschaft mit einem seiner jüdischen Vertreter, Erwin Krotwald in Berlin, den er bis 1938 im Geschäft hält. Krotwald half ihm in den zwanziger Jahren dazu, den Provinzhabitus abzustreifen. In Krotwalds Schicksal der dreißiger Jahre, eine anerkannte bürgerliche Existenz zu verlieren, werden Schatten erkennbar, die später auch nichtjüdischen Bürgern mit den fatalen Folgen von Nationalsozialismus, Krieg und kommunistischer Machtübernahme drohen.
Eine Gegenrolle spielt Eugens Schwager Otto Zwiemann, Besitzer einer kleinen Emaillefabrik im selben Ort, der ihm als Mitglied der erweiterten Familie zum Stachel im Fleisch wird, nachdem er sich früh den Nationalsozialisten anschließt. Ein ehrgeiziger Kleinunternehmer mit Doktortitel, dem der Ort zu eng wird und der seinen Willen zu Großem mit kühnen Bergsteigertaten auslebt. Unter der Decke bürgerlichen Wohlverhaltens entbrennt der Kampf zwischen ihm und Eugen, den seine „Gegen“-Matterhorn-Besteigung an die Grenzen der Kräfte führt. Dorothee steht diesem Kampf als einer Männersache zornig und hilflos gegenüber. Sie ahnen, dass Eugen bei der Abwehr der Nazi-Intrigen verpflichtet wird.
Für Dorothee entpuppt sich die Frau des Amtsrichters, Wilhelmine Wildermuth, die zunächst als Hüterin nationalkonservativer Bürgerlichkeit erscheint und sie als gesellschaftliches Leichtgewicht abtut, als eine inspirierende und kompetente Mentorin. Sie ist die Einzige, die ohne politische Scheuklappen die Übersicht über das behält, was in einem solchen Leben für eine selbstständige Frau wichtig ist.
Mit der Darstellung der Region zwischen Dresden, Chemnitz und dem Erzgebirge eröffnet dieser Roman die fast vergessene Geschichte vom Aufstieg des sächsischen Wirtschaftsbürgertums, das sich in den dreißiger Jahren vielfach — aber nicht immer — dem Nationalsozialismus verschrieb. Es ist kein Nostalgie- oder Erinnerungsroman, der das verflossene Bildungsbürgertum à la Thomas Mann zurückruft, sondern eine fesselnde Darstellung dieser für das industrielle Deutschland kennzeichnenden Gesellschaftsschicht, die in Sachsen eine eigene kulturelle Dynamik entwickelte.
Über den Autor
Prof. Dr. Frank Alfred Trommler wurde 1939 als drittes und jüngstes Kind in der Familie Ernst und Dorothea Trommler aus Zwönitz geboren. Seine Vorfahren waren seit dem 19. Jahrhundert im Erzgebirge verwurzelt und hatten dort die bedeutende Schuhfabrik
A. Trommler gegründet. Sein Vater baute diese Fabrik in den 1920er Jahren nach amerikanischem Vorbild zu einer der größten deutschen Kinderschuhfabrik aus. 1945 wurde Ernst Trommler unter falschen Anschuldigungen verhaftet und blieb bis 1949 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Als er gebrochen aus den sowjetischen Lagern zurückkehrte, wählte er den Freitod. (Siehe: Ernst Trommler: „Ich kann tun, was ich will, ich werde wohl nie aus den Kinderschuhen herauskommen.“, in: Zwischen Aufbruch Anpassung und Untergang - Rotary Club Chemnitz von 1929 bis 1937).
Die Familie, die Mutter Dorothea mit den Kindern, flüchtete in den Westen, wo Trommler aufwuchs. In Offenbach legte er am altsprachlichen Leibniz-Gymnasium 1959 sein Abitur ab. Dort spürte der Gymnasiast die Enge der durch die Restauration der bürgerlichen Lebensweise mitgeprägten Verhältnisse im westdeutschen Wirtschaftswunderland. So fand er als Abiturredner den Mut, vor versammelter Schüler-, Lehrer- und Elternschaft, die Erzieher aufzufordern, sich der NS-Vergangenheit zu stellen. Nach dem Studium der Germanistik und Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin, in Wien und München wurde er 1965 zum Dr. Phil. promoviert. Er erlernte das Handwerk des Journalisten an der Offenbach Post, unternahm Reisen nach Nord- und Südamerika und hielt an Goethe-Instituten in Asien Vorträge über deutsche Kultur. (Siehe: Frank Trommler „Die hellen Jahre über dem Atlantik“, Böhlau Verlag Wien Köln, 2022).
Aufgrund einer Einladung unterrichtete Frank Trommler 1967–1969 als Dozent an der Harvard University für deutsche Literatur und wurde 1970 an der University of Pennsylvania in Philadelphia zum Associate Professor berufen. Damit begann sein Lebensweg als Literaturwissenschaftler in den USA. Als Professor ab 1974 und Gastprofessor an der Princeton und der Johns Hopkins University in Baltimore lehrte er bis zu seiner Emeritierung 2007 an der University of Pennsylvania. 1980–86 leitete er das deutsche Department, übernahm zeitweilig das Programm für vergleichende Literaturwissenschaft und 1996–2000 kommissarisch das slawische Department.
Als Spezialist für moderne deutsche Literatur gehört Trommler zu den ersten westlichen Germanisten, die sich nach 1970 der DDR-Literatur gewidmet haben. Als Leiter des Humanities Program am American Institute for Contemporary German Studies in Washington organisierte er von 1995 bis 2003 die erste und einzige Serie von Workshops für amerikanische Wissenschaftler über die Stellung der Künste in der DDR und ihre Abwicklung.
Trommler engagierte sich intensiv an der Reform der amerikanischen Germanistik zu Germanistik, die das Fach für amerikanische Studenten attraktiv erhielt. 1991/92 stand er der German Studies Association als Präsident vor. In Philadelphia leitete er 1994–99 eine teilweise von deutschen Stellen finanzierte Rettung der größten deutschamerikanischen Bibliothek in den USA.
Zu den Auszeichnungen gehörte 1984 ein Fellowship der Guggenheim Foundation und 2004 das Bundesverdienstkreuz für seine Dienste um die deutsch-amerikanischen Beziehungen. In diesem Jahr erhielt er eine Festschrift mit dem Titel „The Many Faces of Germany. Transformations in the Study of German Culture and History.“
2014 verlieh ihm das Middlebury College in Vermont, die führende Fremdsprachenuniversität der USA, die Ehrendoktorwürde. In seiner Festrede würdigte Trommler das 100-jährige Bestehen der Middlebury Language School, die 1915 von der Germanistin Lilian Ströbel gegründet wurde. Die Jubiläumsveranstaltung brachte über hundert Master- und Doktorstudenten in zehn Sprachen zusammen.
Buchveröffentlichungen:
Roman und Wirklichkeit (1966)
Sozialistische Literatur in Deutschland (1976)
Die Kultur der Weimarer Republik (1978, mit Jost Hermand)
Amerika und die Deutschen (1985, auch auf Deutsch)
Germanistik in den USA (1989)
Berlin: Die neue Hauptstadt im Osten (2000)
Die deutsch-amerikanische Begegnung (2001, auch auf Deutsch)
Weimars transatlantische Mäzen: Die Lincoln-Stiftung 1927–1934 (2008)
Kulturmacht ohne Kompass: Deutsche auswärtige Kulturbeziehungen im 20. Jahrhundert (2014)
Die hellen Jahre über dem Atlantik. Leben zwischen Deutschland und Amerika (2022)
Transatlantische Rivalitäten. Deutsche und amerikanische Einstellungen zu Technik, Kultur und Moderne (2024)